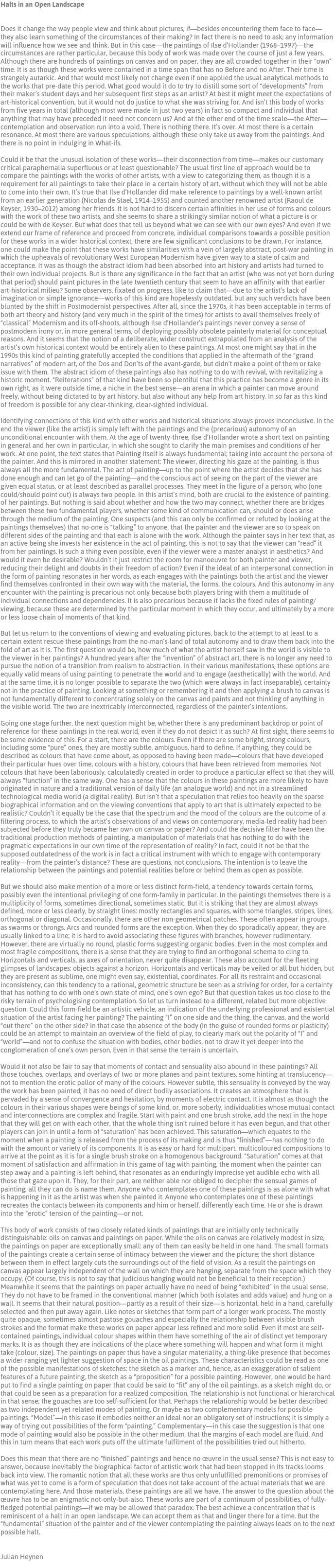
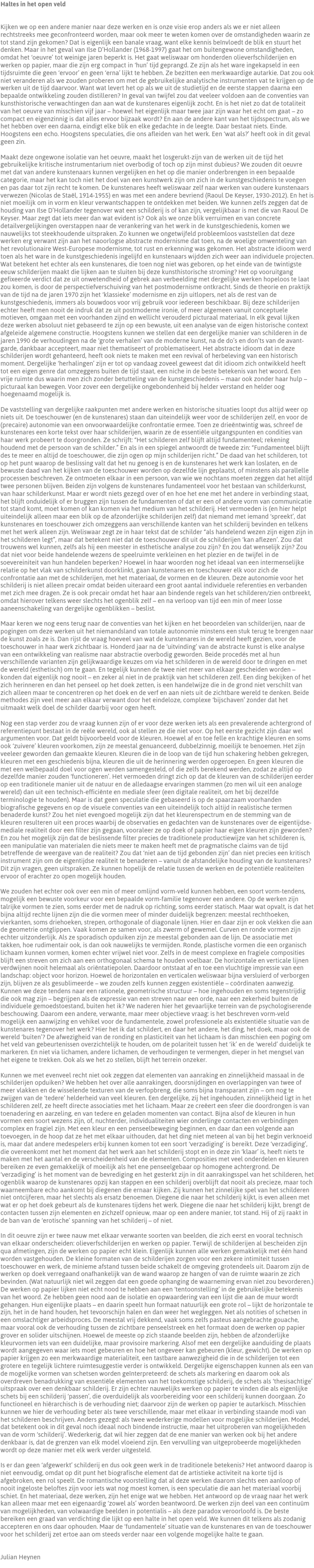
Haltepunkte auf offener Strecke
Ändert sich die Betrachtung und das Nachdenken über diese Bilder, wenn man nicht nur mit ihnen selbst konfrontiert ist, sondern etwas über die Umstände ihrer Entstehung erfährt? Eigentlich eine banale Frage, denn jedes Wissen beeinflusst das Sehen und lenkt das Denken. Hier aber, bei den Bildern von Ilse d’Hollander (1968–1997), sind die Umstände außergewöhnlich, weil sich das „Werk“ auf ganz wenige Jahre beschränkt. Es sind zwar hunderte Ölbilder und Arbeiten auf Papier, aber sie stehen dicht gedrängt in „ihrer“ Zeit. Die Bilder sind gleichsam eingekapselt in einer Zeitspanne, für die kein Vorher und kein Nachher zu existieren scheint. Sie wahren eine eigentümliche Autarkie gegenüber der Zeit der Anderen. Das würde sich wohl auch nicht ändern, wenn man mit den üblichen analytischen Werkzeugen die Arbeiten aus der Zeit davor in den Griff zu nehmen versuchte. Denn was bringt es, wenn man aus der Zeit des Studiums und der ersten Schritte danach irgendwelche „Entwicklungen“ herausdestilliert? Im Zweifelsfall würden sie eher den Konventionen kunsthistorischer Erwartung als dem gerecht werden, was die Künstlerin suchte. Und steht nicht der Block von Arbeiten aus vielleicht fünf, im Kern jedoch nur aus zwei Jahren, um den es geht, viel zu kompakt und eigensinnig vor einem, sodass, was vorher gewesen sein mag, zur Nebensache wird? In die andere Zeitrichtung wiederum, auf ein Danach zu, geht jeder Blick und jeder Gedanke ins Leere. Dort existiert nichts. Ende. Höchstens ein Nachhall. Höchstens Spekulationen, die weg von den Bildern führen. Ein Was-wäre-wenn macht auch in diesem Fall keinen Sinn.
Macht diese ungewöhnliche Isolation, in der die Arbeiten bestehen, macht ihre Herausgerissenheit aus der Zeit nicht das gewohnte kritische Gepäck überflüssig oder zumindest fragwürdig? Da wäre in erster Linie der Vergleich mit anderen Bildern von anderen Künstlern, der die Möglichkeit einer Einordnung suggeriert, so als ob es die Bestimmung aller Bilder sei, sich in eine Kunstgeschichte zu fügen und erst dort zur Geltung zu kommen. Gewiss, die Künstlerin hat selbst auf die Bilder eines bekannten älteren Künstlers (Nicolas de Staël, 1914–1955) hingewiesen und mit einem anderen, ebenfalls bekannten, war sie befreundet (Raoul de Keyser, 1930–2012). Und es fällt nicht schwer, formale und farbliche Verwandtschaften mit beiden zu bemerken, ja, gerade bei letzterem scheint die innere Haltung zu dem, was ein Bild ist oder sein könnte, ähnlich zu sein. Aber was sagt das schon über das Offensichtliche hinaus? Auch wenn man den Blickwinkel erweitert und von konkreten Einzelvergleichen zu einer allgemeinen historischen Verortung der Arbeiten übergeht, gelangt man kaum zu tragfähigen Aussagen. Man könnte zum Beispiel ohne Frage feststellen, dass diese Bilder einer weitgehend abstrakten Nachkriegsmoderne ähneln, in der die Umbrüche der revolutionären Moderne in Westeuropa in einen Zustand der Beruhigung und der Akzeptanz übergegangen sind. Das abstrakte Idiom wird damals gleichsam in die Kunstgeschichte eingemeindet, die Künstler widmen sich individuellen Projekten. Was aber bedeutet es, wenn eine Künstlerin, die damals noch nicht geboren war, am Ende des 20. Jahrhunderts Bilder malt, die diesem kunsthistorischen Milieu nahezustehen scheinen? Das fortschrittsfixierte Verdikt, aus Unkenntnis oder mangelnder Imagination mit solchen Arbeiten hoffnungslos zu spät zu kommen, ist nach der Perspektivverschiebung der Postmoderne stumpf geworden. Liegen in der Theorie und der Empfindung der Zeit nach den 1970er-Jahren doch wie der Rest der Kunstgeschichte so auch die „klassische“ Moderne und ihre Ausläufer als Baukasten zur freien Benutzung bereit. Allerdings hat man bei diesen Bildern nie den Eindruck, dass sie zum Beispiel aus postmoderner Ironie oder allgemeiner: aus konzeptuellen Gründen mit einem vorhandenen, womöglich obsoleten malerischen Material umgehen. Eine bewusste, aus einer Analyse des eigenen historischen Kontextes abgeleitete allgemeine Konstruktion scheint diesen Arbeiten durchaus fremd. Höchstens könnte man sagen, dass eine solche Art des Malens in den 1990er-Jahren die Verhältnisse nach den „großen Erzählungen“ der modernen Kunst, nach den Dos and Don’ts der Avantgarden dankbar akzeptiert, aber nicht thematisiert oder problematisiert. Das abstrakte Idiom, das diese Bilder verfolgen, hat auch nichts mit einem Revival, mit der Wiederbelebung eines historischen Moments zu tun. Solche „Wiederholungen“ hat es bis heute so viele gegeben, dass sich das Idiom zu einem eigenen Genre verdichtet hat, sozusagen außerhalb der Zeit, eine Nische im besten Sinn. Ein Freiraum also, in dem man sich ohne Bevormundung durch die Kunstgeschichte – aber auch ohne ihre Hilfe – malerisch bewegen kann. Soweit eine solche Ungebundenheit bei wachem Verstand und klarem Auge überhaupt irgend möglich ist.
Die Feststellung solcher Berührungen mit anderen Arbeiten und historischen Situationen läuft also immer wieder ins Leere. Der Betrachter (und die Malerin) werden schließlich zurück auf die Bilder selbst geworfen, in die (prekäre) Autonomie einer unbedingten Begegnung mit ihnen. Mit 23 Jahren verfasst die Künstlerin einen kleinen Text über das/ihr Malen, in dem sie sich über die wesentlichen Voraussetzungen und Bedingungen ihrer Arbeit klar zu werden versucht. „Fundamental bleibt immer das Malen selbst; unter Berücksichtigung der Person des Malers“, heißt es dort. Und wie in einem Spiegel antwortet ein zweiter Satz: „Fundamental bleibt umso mehr und stets der Betrachter, der seine Augen auf meine Malereien richtet.“ Der Malakt bis hin zu dem Zeitpunkt, an dem die Entscheidung fällt, dass es nun genug ist und die Malerin das Bild loslassen kann, und der bewusste Sehakt des Betrachters werden gleichsam auf eine Stufe gestellt, zumindest als parallele Prozesse beschrieben. Sie berühren sich in der Instanz der Person, die jedoch, so könnte/müsste man fortfahren, stets zwei Personen bleiben. Beides ist in der Vorstellung der Malerin grundlegend für die Existenz von Malerei, von ihrer Malerei. Aber nichts ist darüber gesagt, ob und wie das eine mit dem anderen in Verbindung steht, ob es Brücken zwischen den Fundamenten gibt, ob irgendeine Art von Kommunikation durch das Medium des Bildes zustande kommt oder kommen sollte oder kommen kann. Der Verdacht ist (und hier hilft letztlich nur der Blick auf die einzelnen Bilder selbst), dass niemand mit jemandem „spricht“, dass sich Malerin und Betrachter sozusagen auf unterschiedlichen Seiten des Bildes befinden und jeweils mit ihm allein sind. Die Malerin, sagt sie zwar in ihrem Text, „investiert als handelndes Wesen ihr Sein in das Malen“, aber das heißt nicht, dass es der Betrachter aus den Bildern „heraus-liest“. Ginge das überhaupt, selbst wenn er ein Meisteranalytiker in aestheticis wäre? Und wäre das wünschenswert? Würde es nicht für beide Handelnden den Spielraum verengen, die Lust und den Zweifel in der Souveränität ihres Tuns beschränken? Auch wenn in ihren Worten noch das Ideal einer interpersonalen Beziehung qua Malerei mitschwingt, vor den Bildern befinden sich Malerin und Betrachter in einer je eigenen Konfrontation mit dem Material, den Formen, den Farben. Prekär ist diese Autonomie vor dem Bild nicht nur, weil beide selbstverständlich eine Vielzahl von individuellen Bezügen und Abhängigkeiten mit sich führen. Prekär ist sie auch, weil ihr die festen Regeln des Malens/Sehens fehlen, weil hierüber immer nur der jeweilige Augenblick – und auf Dauer eine mehr oder weniger lose Kette solcher Augenblicke – entscheidet.
Aber noch einmal zurück zu den Konventionen des Sehens und Beurteilens von Bildern, zurück zu den Versuchen, diese Bilder aus dem Niemandsland völliger Autonomie zumindest ein Stück weit zurück in die Kunst, wie sie ist, zu holen. Da wäre die Frage, wie viel von dem, was die Künstlerin in der Welt gesehen hat, in den Bildern für den Betrachter sichtbar ist. Einhundert Jahre nach der „Erfindung“ der abstrakten Kunst hat sich jedes Entwicklungsdenken vom Realismus zur Abstraktion erübrigt. Beide Vorgehensweisen mit allen ihren unterschiedlichen Spielarten sind gleichwertige Optionen, durch Malen in die Welt einzudringen und mit der Welt (ästhetisch) umzugehen. Und zugleich ist beides nicht mehr, ja, war beides noch nie voneinander zu trennen, schon gar nicht in der Praxis des Malens selbst. Auf ein Ding zu blicken oder sich daran zu erinnern und dann den Pinsel auf die Leinwand zu setzen, ist ein Vorgang, der sich nicht grundsätzlich davon unterscheidet, nur auf die Leinwand und die Farben zu blicken und an nichts in der sichtbaren Welt zu denken. Beides verbindet sich vielmehr in unendlich komplexen Schleifen, ganz gleich welche Absicht den Maler jeweils leitet.
Einen Schritt weiter könnte die Frage lauten, ob es so etwas wie einen vorherrschenden Hintergrund oder Bezugspunkt für diese Bilder in der realen Welt gibt, auch wenn sie ihn nicht darstellen. Auf den ersten Blick spricht einiges dafür. Da wären die Farben zu nennen. Auch wenn es mitunter helle und kräftige und dann und wann auch „reine“ Farben gibt, sind die meisten doch abgetönt, mehrdeutig, schwer zu benennen. Es sind eher gewordene als gemachte Farben. Farben, die im Laufe der Zeit ihre Tönung angenommen haben, Farben mit einer Geschichte sozusagen, Farben, die aus der Erinnerung hervorgeholt wurden. Und nicht solche, die mit einer bestimmten Wirkabsicht so und so hergestellt, gleichsam berechnet wurden, damit sie immer in der gleichen Weise „funktionieren“. Die Vermutung liegt nahe, dass die Farben der Bilder eher aus der Natur und dem gelebten Alltag traditioneller Prägung herrühren (aus einer analogen Welt, wenn man so will), und nicht aus einer technisch-effizienten und medialen Sphäre (einer digitalen Realität, um auch dieses Wort zu gebrauchen). Aber ist das nicht eine Spekulation, die sich an das spärlich vorhandene Biografische und an die Sehkonventionen einer letztlich doch immer realistisch gedachten Kunst hält? Könnte es nicht ebenso gut sein, dass Farbspektrum und Farbstimmung das Resultat eines Filters sind, durch die die Beobachtungen und Gedanken der Künstlerin vis-à-vis einer zeitgenössisch-medialen Realität gegangen sind, bevor sie auf der Leinwand oder auf dem Papier wirklich ihre eigenen wurden? Und wäre womöglich der entscheidende Filter dabei gerade die traditionelle Produktionsweise des Malens, eine Manipulation von Materialien, die mit den pragmatischen Ansprüchen der Zeit an die Wiedergabe der Realität nichts mehr zu tun hat? Wäre das Unzeitgemäße dann nicht gerade ein kritisches Instrument, um der zeitgenössischen Realität zu begegnen – aus der Distanz der Malerin? Das sind Fragen, keine Aussagen. Sie möchten das Verhältnis zwischen den Bildern und den möglichen Realitäten vor oder hinter ihnen so offen wie möglich halten.
Da wäre aber auch ein mehr oder weniger bestimmtes Form-Feld zu nennen, eine Art Form-Tendenz, womöglich eine absichtsvolle Bevorzugung einer Form-Familie gegenüber einer anderen. Auf den Bildern erscheint eine Vielzahl von Formen, mal eher richtungsbetont, mal eher statisch. Aber auffällig ist, dass es fast immer gerade Linien sind, die sie mehr oder weniger deutlich begrenzen: meist Rechtecke, Quadrate, mitunter Dreiecke, Streifen, Linien, orthogonal oder diagonal. Hier und da gibt es auch Flecken, die sich der Geometrie entziehen. Sie treten häufig im Verbund, als Schwarm oder Gewimmel auf. Der Bogen und die runde Form bleiben dagegen die Ausnahme. Wenn sie sporadisch auftauchen, dann sind sie zumeist an die Linie gebunden; die Assoziation an ein noch so rudimentäres Geäst ist dann kaum zu vermeiden. Auf runde, plastische Formen im Sinne organischer Körper trifft man jedoch so gut wie nicht. Noch in den komplexesten und fragilsten Kompositionen bleibt ein Bestreben spürbar, an einem orthogonalen Schema Halt zu suchen. Die Horizontale und die Vertikale verschwinden als Pole der Orientierung nie ganz. Daher auch mitunter die flüchtigen Anmutungen von Landschaft: Objekt vor Horizont. Horizontale und Vertikale mögen verschleiert oder beinahe verborgen sein, aber sie sind als sublime, fast möchte man sagen: existentielle Koordinaten präsent. Darf man diese Tendenz zu einer rationalen, geometrischen Struktur – so verhalten und mitunter widersprüchlich sie sein mag – als Ausdruck eines Strebens nach einer Ordnung, nach einer Sicherheit außerhalb der individuellen Befindlichkeit, jenseits des Ich verstehen? Wir nähern uns einem gefährlichen Terrain psychologisierender Betrachtung. Daher eine andere, verwandte, aber objektivere Frage: Ist das beschriebene Form-Feld womöglich Anzeichen und Vehikel für die grundlegende, sowohl professionelle wie existentielle Situation der Malerin vor dem Bild? Hier das Ich, das malt, und dort das Andere, das Ding Leinwand, aber auch die Welt „draußen“? Die Abwesenheit des Körpers qua Rundung und Plastizität wäre dann vielleicht der Versuch, das Ereignisfeld überschaubar zu halten, die Polarität „Ich“ und „Welt“ deutlich zu markieren. Und nicht via Körper, anderer Körper, die Verhältnisse zu vermischen, tiefer in das Gemenge des Eigenen zu ziehen. Auch so gefragt bleibt das Terrain unsicher.
Könnte man mit einigem Recht nicht ebenso sagen, dass Elemente von Berührung und Sinnlichkeit zuhauf in den Bildern erscheinen? Gemeint sind all die Berührungen, Überschneidungen und Überlagerungen zweier oder mehrerer Flächen und die wechselnden Texturen des Farbauftrags bis hin zur angedeuteten Transparenz – von der „zärtlichen“ Helle vieler Farben zu schweigen. Solch eine, wenn auch verhaltene, Sinnlichkeit liegt in der Malerei selbst, sie bedarf nicht der direkten Körperassoziation. Aber sie schafft eine Atmosphäre, die von Annäherung und Zögern sowie sanften elektrischen Momenten des Kontakts durchzogen ist. Fast als ob die Farben in ihren Formen eine Art von Wesen wären oder, nüchterner, Individualitäten, deren Kontakt und Verbindung miteinander komplex und fragil ist. Mit einer Farbe und einer Pinselbewegung anfangen und dann eine nächste hinzufügen in der Hoffnung, dass sie es miteinander aushalten, dass die Sache nicht gleich im Ansatz verpfuscht ist, sondern dass weitere Mitspieler hinzukommen können, bis eine Art „Sättigung“ erreicht ist. Diese „Sättigung“, die dem Moment entspricht, an dem ein Bild aus der Arbeit an ihm entlassen wird und in diesem Sinne „fertig“ ist, hat nichts mit der Anzahl und Unterschiedlichkeit der Elemente zu tun. Vielteilige und -farbige Kompositionen erreichen ihn so leicht oder so schwer wie die eine Pinselgeste auf homogenem Grund. Die „Sättigung“ ist der Moment der Befriedigung und des Gestärktseins in diesem Berührungsspiel der Malerei, der Augenblick, in dem die Malerin beiseitetreten kann und ein Bild übrig bleibt, das als niemals präzises, aber vernehmliches Echo bei denen ankommt, die darauf blicken. Sie wiederum müssen, sie können die sinnlichen Spiele des Malens nicht entschlüsseln, sondern nur ersatzweise benennen. Wer auf das Bild blickt, ist so allein mit dem Geschehen auf ihm wie die Malerin bei ihrer Arbeit. Wer auf das Bild blickt, stellt die Kontakte zwischen seinen Elementen und ihm selbst erneut, aber anders her. Er oder sie gerät in die „erotische“ Spannung der Malerei – oder auch nicht.
Es gibt in diesem Werk zwei eng miteinander verwandte Arten von Bildern, die sich zuerst einmal nur technisch unterscheiden: die Ölgemälde und die Arbeiten auf Papier. Sind schon die Gemälde von bescheidenen Ausmaßen, so sind die Arbeiten auf Papier ausgesprochen klein; eigentlich alle können leicht von einer Hand gehalten werden. Die kleinen Formate der Gemälde befördern eine gewisse Intimität zwischen Betrachter und Bild, der gemäßigte Abstand zwischen beiden blendet das Umfeld zu einem guten Teil aus. Die Leinwandbilder sind so weitgehend unabhängig von der Wand, auf der sie hängen, vom Raum, in dem sie sich befinden. (Was selbstverständlich nicht heißt, dass eine kluge Platzierung ihre Wahrnehmung nicht fördern könnte.) Die Arbeiten auf Papier scheinen eine „Ausstellung“ im üblichen Sinn eigentlich gar nicht zu brauchen; sie müssen nicht der isolierenden und aufwertenden Konvention folgend gerahmt an der Wand in Erscheinung treten. Ihr eigentlicher Ort scheint, und da spielt nicht zuletzt die Größe eine Rolle, die Horizontale zu sein, das In-der-Hand-halten, das Hervorholen und dann wieder das Weglegen. Eben wie Notizen oder Skizzen in einem weitläufigeren Arbeitsprozess. Die meist ziemlich deckend, manchmal fast pastos aufgetragenen Gouachefarben, besonders aber auch das Verhältnis zwischen sichtbarer Pinselspur und Format lässt die Arbeiten auf Papier gröber und fester erscheinen. Auch wenn die meisten in sich abgeschlossene Bilder sind, haben die einzelnen Farbformen etwas von einer deutlichen, aber provisorischen, Markierung. So als würde mit einer solchen Setzung die Stelle bezeichnet, wo etwas geschehen soll und wie es in etwa geschehen könnte (Farbe, Gewicht). Die Arbeiten auf Papier erhalten so eine eigentümliche Materialität, eine dinghafte Präsenz, die in den Gemälden zu einer größeren und zugleich leichteren Raumsuggestion weiterentwickelt ist. Solche Eigenschaften könnten als eine der möglichen Ausformungen von Skizzen gelesen werden: die Skizze als Markierung und das heißt auch Überbetonung wesentlicher Elemente des zukünftigen Bildes, die Skizze als „thesenhafte“ Aussage über ein denkbares Bild. Nun wird man allerdings kaum je eine Papierarbeit finden, die als Skizze im üblichen Sinn zu einem Gemälde „passt“, die unmittelbar nachvollziehbar als Vorarbeit zu einer Ausführung gelten kann. So funktional und hierarchisch ist das Verhältnis nicht; dafür sind die Arbeiten auf Papier zu autark. Vielleicht kann man das Verhältnis besser als zwei verschiedene, aber aufeinander bezogene Modi des Malens dieser Künstlerin beschreiben. Oder anders: als zwei gegenseitige Modelle für mögliche Bilder. Modell, das heißt auch in diesem Fall weder Ideal noch verbindliche Handlungsanweisung, sondern Erproben von Möglichkeiten der Form „Bild“. Gegenseitig, das soll hier heißen, dass der eine Malmodus auch im anderen denkbar wäre, dass die Ränder jedes Modells fließend sind. Eine Erfüllung der so durchgespielten Möglichkeiten wird auf diese Weise mit jeder Arbeit weiter hinausgezögert.
Gibt es also kein „fertiges“ Bild, und damit auch kein Werk im herkömmlichen Sinn? Die Antwort fällt nicht leicht, weil sich an diesem Punkt unweigerlich das biografische Moment der nach kurzer Zeit abgebrochenen künstlerischen Tätigkeit in die Betrachtung schiebt. Die romantische Vorstellung, dass alle diese Arbeiten demnach nur Vorahnungen oder Versprechen auf etwas Künftiges sind, die nie eingelöst werden, geht spekulativ am Material vorbei. Und das Material, diese Bilder, sind das einzige, was wir haben. Die Antwort auf die Frage nach dem Werk kann wohl nur mit einem eigentümlichen Sowohl-als-auch beantwortet werden. Die Arbeiten sind Teil eines Kontinuums von Möglichkeiten, von vollgültigen Bildern im Potentialis – wenn dieses Paradox erlaubt ist. Die besten erreichen einen Grad von Verdichtung, der einem Haltepunkt auf offener Strecke gleicht. Man kann ihn jeweils als solchen akzeptieren und dort verweilen. Aber die „fundamentale“ Situation der Malerin und des Betrachters vor dem Bild drängt stets weiter zum nächsten möglichen Haltepunkt.
Julian Heynen
TEXTS
copyright © The estate of Ilse D'Hollander - c/o Ric Urmel